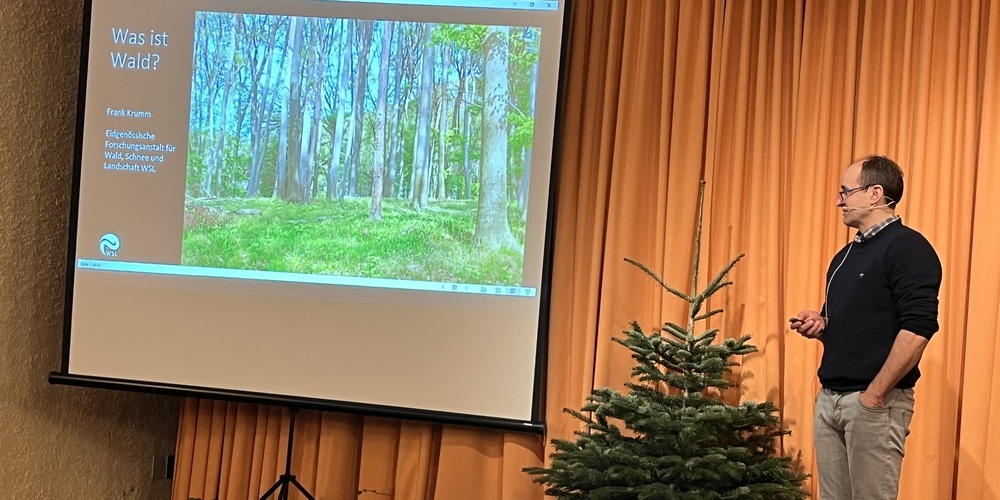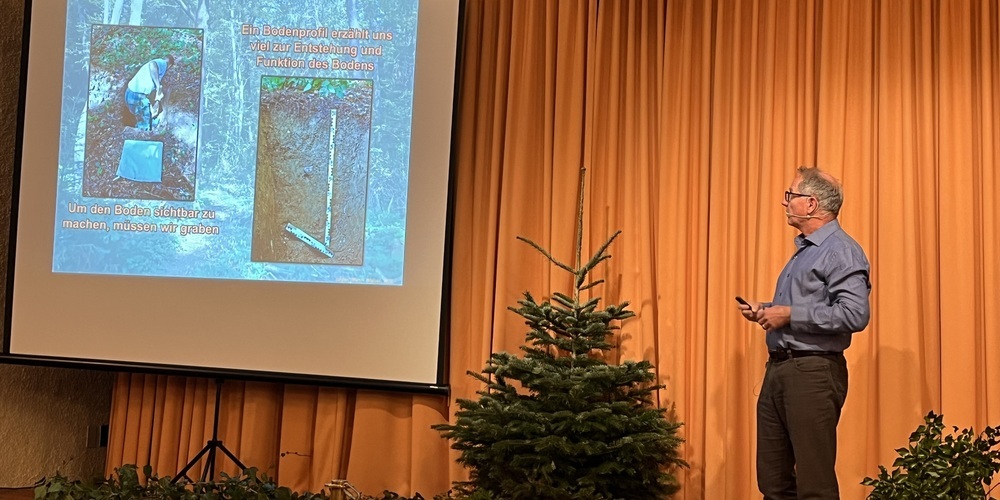«Sie alle haben sicher schöne Erinnerungen an den Wald, vor allem aus der Kindheit», begrüsste die ehemalige Gemeindepräsidentin Susanna Jenny die Anwesenden zum Vortrag «Was ist ein Wald?». Eingeladen hatten die IG Tägernauerholz DepoNie, die Gemeinden Grüningen und Gossau sowie die Naturschutzvereine Grüningen und Gossau, um mehr über den Wald und dessen Beschaffenheit zu erfahren.
Mehr als eine Ansammlung von Bäumen
Heute sei der Wald nicht mehr ganz so toll, er leide unter vielen Faktoren und dies nehme vor allem dort zu, wo er nicht bewirtschaftet werden könne, so Jenny weiter. Doch ein Wald sei mehr als nur eine Ansammlung von Bäumen, was den Zuhörenden die beiden Referenten Dr. Frank Krumm und Jörg Luster von der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL den Anwesenden näher bringen würden.